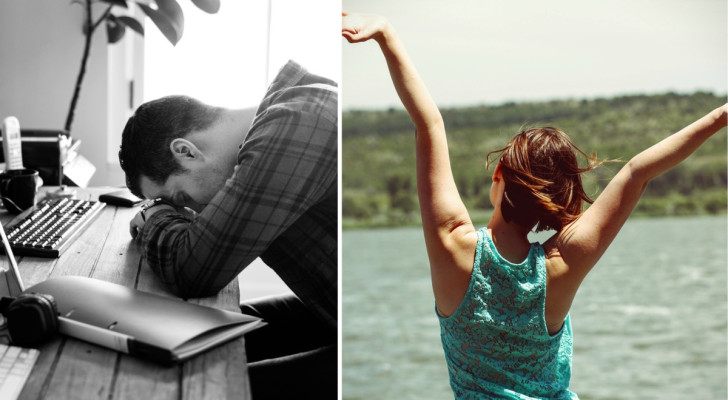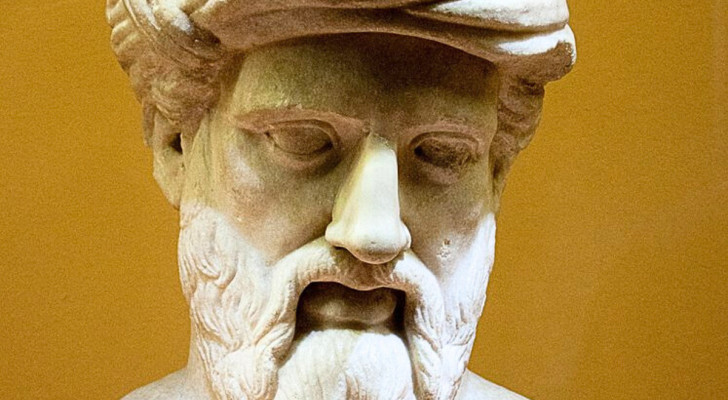Warum fühlen wir uns manchmal so gut, wenn wir uns rächen? Die Wissenschaft erklärt es

Lohnt es sich, sich für erlittenes Unrecht zu rächen? Die Antwort ist sicherlich subjektiv, aber Psychologen wollten dieses menschliche Verhalten untersuchen, um mehr darüber herauszufinden.
Wird Rache oder das Vergnügen, sich zu rächen, beurteilt?

Freepik
Rache gehört sicher nicht zu den menschlichen Verhaltensweisen, die als besonders lobenswert gelten, und doch stellt sie für viele eine große Versuchung dar. Ein Unrecht, noch dazu ein ungerechtes, kann ein legitimes Verlangen nach Rache auslösen, auch wenn die Umsetzung in die Praxis moralische Fragen aufwirft. Nimmt man die „Gerechtigkeit“ an oder lässt man sie gewähren und erweist sich als überlegen, obwohl man die Möglichkeit der Rache hat?
Im allgemeinen Denken ist Rache etwas Falsches. In der Praxis scheint dies jedoch nicht so zu sein: Viele applaudieren denjenigen, die auf die erhaltene Beleidigung oder Kränkung reagieren, obwohl es sehr darauf ankommt, wie man sich entscheidet, die Beleidigung zu erwidern. Das Forscherteam um Karolina Dyduch-Hazar, Professorin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, und Dr. Mario Gollwitzer von der Ludwig-Maximilians-Universität München, wollte der Sache auf den Grund gehen: Ist die Rache an sich schuld oder das emotionale Vergnügen, das sich aus der Ausübung der Rache ergibt?
Die soziale Bewertung von Rache: die Umfrage
Die Forscher haben vier Umfragen zu diesem Thema durchgeführt, drei davon mit Gruppen von polnischen Studenten, die vierte mit amerikanischen Erwachsenen. Die Teilnehmer mussten sich als hypothetische Rächer, aber auch als bloße Zuschauer von Racheaktionen vorstellen. Den Ergebnissen zufolge berichteten die Autoren, dass diejenigen, die sich für Rache entscheiden, auf sozialer Ebene zwar unterstützt und gebilligt werden, aber im Vergleich zu Menschen, die Rache vermeiden wollen, dennoch getadelt werden.
Die Studienteilnehmer wurden gebeten, fiktive Situationen zu bewerten, in denen Personen, die Rache ausübten, dabei Befriedigung empfanden. Diese fiktiven Rächer wurden als kompetent, geschickt und effizient beschrieben. Andererseits wurden diese Qualitäten von den fiktiven Personen, die sich gerächt hatten, aber tiefe Schuldgefühle empfanden, nicht anerkannt. Auch nicht bei denjenigen, die in der unwirklichen Situation auf die Rache verzichtet hatten. Den Forschern zufolge ist diese merkwürdige Anerkennung in diesem Fall darauf zurückzuführen, dass Rächer, die stolz auf ihre Rache waren, als fähig angesehen wurden, ein Ziel zu erreichen.
Die Ergebnisse der Racheumfrage

rawpixel.com
Wenn die imaginären Rächer ihre Rache jedoch genossen, zögerten die Umfrageteilnehmer nicht, ihnen ein schlechtes Moralempfinden zu unterstellen. „Das Vergnügen nach einer Racheaktion könnte darauf hindeuten, dass die ursprüngliche Motivation nicht darin bestand, dem Täter eine moralische Lektion zu erteilen, sondern sich gut zu fühlen - ein egozentrisches und moralisch fragwürdiges Motiv“, erklärten die Autoren.
Darüber hinaus ergab sich eine Divergenz, wenn sie mit der gleichen imaginären Situation konfrontiert wurden, was auf die unterschiedlichen Positionen der Teilnehmer zurückzuführen war: Akteure und Beobachter. Wenn ein Proband in die Rolle des Rächers schlüpfte, schätzte er sich selbst als weniger moralisch ein als ein anderer Teilnehmer, der sich rächte. Und nicht nur das, sie hielten ihn auch für besser im Rachefeldzug. Den Wissenschaftlern zufolge widerlegt dies frühere Theorien, wonach wir, wenn wir über andere Menschen urteilen, deren Handlungen aus einer moralischen Perspektive bewerten, während persönliche Urteile auf dem Gefühl der Kompetenz beruhen. Darüber hinaus stellten die Autoren fest, dass das Gefühl des Wohlbefindens im Gegensatz zum Gefühl des Unbehagens, das sich aus der Rache ergibt, keinen Einfluss auf die Entscheidung hatte, diese zu verfolgen. Die meisten Teilnehmer gaben jedoch an, dass sie den Weg des Verzichts bevorzugen: eine Entscheidung, die offenbar nicht mit der Angst vor den Konsequenzen oder den Urteilen anderer zusammenhängt.